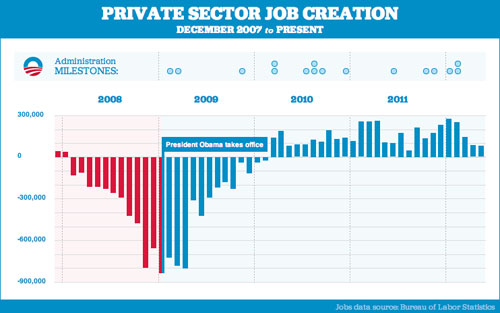Vor vier Jahren, als sich Barack Obama gegen seinen republikanischen Gegenspieler John McCain durchsetzte, wurde hierzulande vor allem seine Social Media-Kampagne beachtet. Dabei war eine der tragenden Säulen seines Wahlkampfs alles andere als virtuell: Lokale Wahlkampfbüros, sogenannte „field offices“, könnten ihm 2008 den Einzug ins Weiße Haus gesichert haben. Die Republikaner haben das nicht vergessen – scheinen das ground game aber 2012 wieder zu verlieren.
In einem großen Land wie den USA ist es alles andere als billig, ein flächendeckendes Netz aus Wahlbüros zu knüpfen. Doch die Obama-Kampagne hatte 2008 jede Menge Geld in der Tasche und konnte sich daher rund 700 field offices leisten (während das McCain-Camp es nicht einmal auf 400 Büros brachte). Dieser Vormachtstellung im ground game wird von Experten ein nicht unwesentlicher Anteil an Obamas Wahlerfolg vor vier Jahren zugeschrieben. So ergab eine Untersuchung der damaligen Wahlergebnisse in Colorado, dass die Demokraten in Counties mit einem field office im Schnitt deutlich höhere Stimmengewinne erzielten (+6,3 %) als in solchen ohne Kampagnenbüro (+4,5 %). Trotz aller Schwankungen lag der Stimmenzuwachs für Obama in Counties mit einem Büro nie unter 3 %. Damit ist klar: In einem heiß umkämpften swing state können field offices den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.
Dort, wo die WählerInnen sind
Nüchtern ausgestattete Räume, die nur behelfsmäßig mit Wahlkampfpostern und selbstgemalten Schildern dekoriert werden, billige Kampagnenfilialen, die ebenso rasch ihren Betrieb aufnehmen wie sie nach der Wahl wieder verschwinden – warum sind lokale Wahlkampfbüros so wirksame Kampagneninstrumente? Ganz einfach: Weil sie dort sind, wo die WählerInnen sind. Was in Österreich, wo die größeren Parteien auch in kleinen Gemeinden über eine Ortsorganisation verfügen, eher selbstverständlich wirkt, muss in den USA – wo die Parteien weitaus weniger stark organisiert sind – in einem immensen Kraftakt sichergestellt werden.
Dabei geht es weniger darum, den Freiwilligen einen Ort zu bieten, wo sie sich treffen können, um yard signs zu basteln. Im „Feld“ wird vielmehr der persönliche Kontakt zu den Wahlberechtigten organisiert – das Klopfen an Haustüren, die Telefonanrufe, die lokalen Veranstaltungen. Diese Aktivitäten sind für jede Kampagne außerordentlich wichtig, um ein möglichst vollständiges und aktuelles voter file – also ein Verzeichnis der WählerInnen in der Region – aufzubauen. In dieser Datenbank wird vermerkt, wer sicher oder sehr wahrscheinlich für den eigenen Kandidaten stimmen wird – und daher im Zuge des „Get out the vote“ (GOTV) zu mobilisieren ist. Social Media hin, TV-Werbung her: Wer die eigenen WählerInnen identifizieren und an die Wahlurne bringen möchte, muss vor Ort sein (auch wenn es dafür immer mehr digitale Unterstützung gibt, wie Yussi neulich im TechTuesday erläuterte).
Kleine Fragen statt große Antworten
Die Obama-Kampagne ist sich der Bedeutung ihrer field operations jedenfalls sehr bewusst. So wie schon 2008 arbeitet sie hart daran, Freiwillige – mit ihrem Schlachtruf „Fired up, ready to go!“ – zu mobilisieren. Dafür setzt sie auch Videos wie dieses hier (aus dem swing state Iowa) ein. Es vermittelt ein gutes Bild davon, worauf es im Wahlkampf vor Ort ankommt: Nicht auf die großen Antworten, sondern auf die kleinen Fragen …
Romneys „Victory Offices“
Die Republikaner haben nicht vergessen, dass sie das ground game 2008 verloren haben und wirken – zumindest in Interviews – sehr entschlossen, es in diesem Jahr besser zu machen. Selbstbewusst bezeichnet das Romney-Camp seine regionalen Kampagnenbüros als „Victory Offices“ – doch nach offiziellen Angaben hält der Herausforderer von Barack Obama erst bei rund 250 davon. Deren Zahl wird in den nächsten Wochen wohl noch deutlich steigen, nachdem Romney inzwischen im Fundraising die Oberhand gewinnt. Seine Kampagne muss sich allerdings sehr beeilen, wenn sie erfolgreich sein will, denn noch hat Obama – der unbehelligt von Vorwahlen deutlich früher als Romney mit dem Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur beginnen konnte – die Nase deutlich vorne.
So stehen z. B. im battleground state Colorado (einem Bundesstaat mit rund fünf Mio. EinwohnerInnen) 32 Obama-Büros erst zehn „Victory Offices“ von Romney gegenüber. Angesichts der Tatsache, dass WählerInnen durch die Briefwahl in manchen Bundesstaaten wie z. B. Iowa bereits 40 Tage vor dem 6. November ihre Stimme abgeben können (also in weniger als 50 Tagen), bleibt Romney nicht mehr viel Zeit, seinen Rückstand in Sachen field offices aufzuholen.
Freiwillige vor
Doch selbst eine Vervielfachung seiner Regionalbüros wäre noch keine Garantie für Mitt Romney, das ground game zu gewinnen – Infrastruktur ist schließlich nur die halbe Voraussetzung für eine erfolgreiche Feldarbeit. Die andere Hälfte sind freiwillige HelferInnen, die man vor Ort mit allen möglichen Mitteln zu motivieren versucht. So bekommen Romney-UnterstützerInnen z. B. für 65 Telefonanrufe nicht nur ein Schulterklopfen, sondern auch einen Autoaufkleber. (Kampagnenmaterialien werden in den USA nämlich nicht – wie bei uns – verschenkt, sondern als Merchandising-Artikel zur Finanzierung des Wahlkampfs verkauft.) Für 250 Anrufe gibt es ein Schild für den Vorgarten und für 10.000 Anrufe sogar ein Treffen mit dem Kandidaten himself. Sollte jetzt jemand über die Republikaner schmunzeln: Diese Gamification des Wahlkampfs gibt es auch bei Barack Obama, dessen Kampagnenplattform Dashboard ein paar kompetitive Elemente enthält. Warum auch nicht? Politische Arbeit darf schließlich auch Spaß machen …